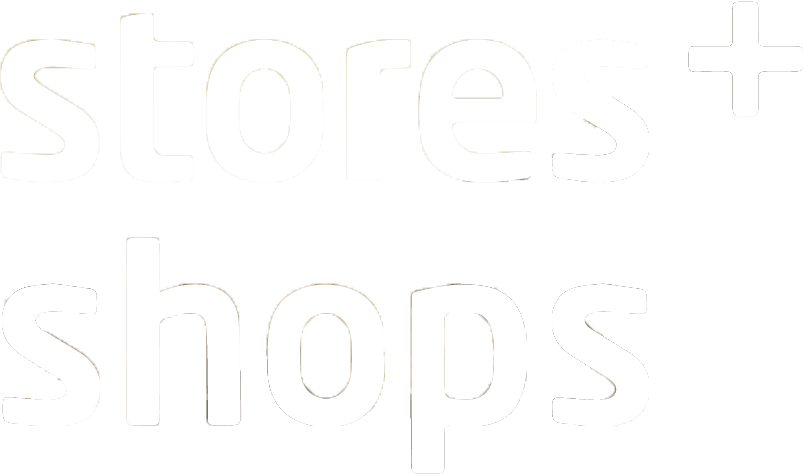Was ist an dem Thema „Mieten statt kaufen“ so aktuell?
Möller: Zukunftsforscher sehen darin einen neuen Trend. Mieten und Leasen sind zwar keine neuen Phänomene, insbesondere Investitionsgüter wie Autos und Immobilien werden ja seit Langem geleast bzw. gemietet. Neu ist hingegen, dass wir seit einiger Zeit einen Übergang in den kleinteiligen Bereich klassischer Konsumgüter beobachten können, beispielsweise das Mieten von Handtaschen über die Internetseite „Luxusbabe“ oder im B2B-Bereich das Leasen von Firmensoftware.
Was bewegt einen Konsumenten dazu, ein Produkt zu mieten statt zu kaufen?
Wittkowski: Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund ist sicherlich, dass die Bedeutung von Eigentum als Statussymbol zurückgeht. Überrascht hat mich, dass der Faktor Umweltbewusstsein bei der Entscheidung für das Mieten und gegen das Kaufen eine eher untergeordnete Rolle spielt. Interessant ist auch, dass der Faktor Preisbewusstsein bei der Entscheidung für das Mieten keinen signifikanten Einfluss ausübt. Hingegen sind Komfort- und Erlebnisorientierung sowie die Präferenz für Nicht-Eigentum positive Einflussfaktoren.
Möller: Blickt man auf die 80er-Jahre zurück, sieht man, dass dem Eigentum in dieser Zeit noch eine viel höhere Bedeutung zugemessen wurde als heute. Heute kann man eher von einer Konsumbescheidenheit der Verbraucher sprechen.
Ist der Trend „Mieten statt kaufen“ nur ein Strohfeuer, oder haben wir es mit einer grundlegenden Veränderung im Verhalten der Konsumenten zu tun?
Möller: Die Veränderung im Konsumverhalten ist sicherlich ein langfristiges Phänomen. Zum Beispiel hat sich in den USA dieser Trend bereits stärker etabliert als in Deutschland. Es ist dort viel normaler, sogar die gesamte Wohnungseinrichtung zu mieten und nicht zu kaufen.
Woran liegt das?
Möller: Mobilität und Risikofreude spielen in den USA kulturell bedingt eine größere Rolle als in Deutschland. Aber auch bei uns ändert sich das Konsumentenverhalten: Eigentum wird immer mehr als Ballast wahrgenommen. Ein Beispiel: Für die junge Generation ist es heute einfach nicht mehr en vogue, sich auf ein Porzellan-Tafelservice fürs Leben festzulegen.
Hat der Handel diesen Trend bisher zu stark ignoriert?
Wittkowski: Da das existierende Geschäftsmodell des Handels die Eigentumsübertragung beinhaltet, sind Mietgeschäfte nur schlecht bzw. gar nicht damit vereinbar. Es müssten also große Anstrengungen unternommen werden, um das Mietgeschäft zu integrieren. Durch die Integration von Nicht-Eigentum-Angeboten in das existierende Geschäftsmodell können Händler sich von Wettbewerbern differenzieren. Bisher haben aber nur sehr wenige traditionelle Händler das Mietgeschäft in ihr Angebot aufgenommen.
Möller: Der Handel hat die Infrastruktur und die Denke noch nicht. Es ist eine Frage der Marge, denn ein Kunde, der mietet, kommt mehrmals. Dieses Konzept macht Händler zu Dienstleistern. Aber zurzeit fehlt noch die Infrastruktur: Personal, Lager, Service etc. Häufig sieht man, dass sich entweder Hersteller oder neue Anbieter dieses Geschäft zu eigen machen. Zum Beispiel sind nicht die Autovermieter diejenigen, die Car-Sharing-Angebote machen, sondern die Automobilhersteller wie Daimler und BMW oder die Bahn. Auch Peer-to-Peer-Angebote wie die Internetplattform „erento“, auf der man Produkte und Dienstleistungen von Privatpersonen in seiner Nähe mieten kann, könnten zu Ernst zu nehmenden Konkurrenten des Handels werden. Der Handel könnte aber auch sagen: Wenn das Ganze Marktpotenzial hat, dann mache ich es doch lieber selbst.
Sehen Sie in dem veränderten Konsumentenverhalten eine Bedrohung oder eine Chance für den Handel?
Möller: Ich sehe in diesem Trend durchaus eine Chance für den Handel — wenn ein Umdenken stattfindet und vor allem Dienstleistungen mitangeboten werden. Wenn man das Ganze etwas größer denkt und ein Portfolio an Dienstleistungen anbietet, wird man zur ersten Anlaufstelle für alles, was anfällt — für Miet- und Kaufgeschäfte. Das Ganze läuft zurzeit noch sehr reaktiv ab: Das heißt, wenn ein Kunde ein Produkt leihen möchte, geht er auf den entsprechenden Anbieter zu. Der Handel könnte mit der passenden Infrastruktur jedoch kapazitätsgesteuert aktiv feststellen, was der Kunde möchte.
Wittkowski: Der Handel hat im Gegensatz zu den Herstellern den direkten Zugang zu den Kunden, kennt die Bedürfnisse und sollte dieses Wissen nutzen, bevor Hersteller ihm den Rang ablaufen.
Sehen Sie die Notwendigkeit eines stärkeren Wissenstransfers von der Forschung in den Handel?
Möller: Ja, zunächst besteht Bedarf an mehr Forschung in dem Bereich und in einem zweiten Schritt auch an mehr Transfer von Wissen in den Handel und dann wiederum zurück in die Forschung. Zum Beispiel stellen wir uns die Frage, welche Implementierungsprobleme der Handel bei der Umsetzung haben könnte und welche Produkte sich für Mietgeschäfte tatsächlich eignen und welche eher nicht. An diesem Punkt sehe ich durchaus Bedarf an konkreten Kooperationen zwischen Wissenschaft und Handel.
Frau Wittkowski, welche Auswirkungen hat die Verleihung des Wissenschaftspreises 2012 auf Ihre wissenschaftliche Laufbahn gehabt?
Wittkowski: Für mich ist die Praxisrelevanz meiner Arbeit sehr wichtig. Da mit dem Wissenschaftspreis Arbeiten ausgezeichnet werden, die eine hohe Praxisrelevanz für den Handel haben, war die Verleihung eine tolle Bestätigung für mich. Ich habe Kontakte sowohl zu Praktikern als auch zu anderen Wissenschaftlern knüpfen können, aus denen sich neue Ideen für gemeinsame Forschungsprojekte entwickeln können.
Das Interview führten Marlene Lohmann und Vanessa Tuncer.
Praxis-Transfer: Der Wissenschaftspreis
Der Wissenschaftspreis ist ein Gemeinschaftsprojekt des EHI Retail Institute, der GS1 Germany und der Akademischen Partnerschaft mit dem Ziel, den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Handel zu intensivieren. Die mit insgesamt 40.000 Euro dotierten Preise in den Kategorien beste Bachelor- oder beste Masterarbeit, beste Dissertation sowie beste Kooperation werden am 20. Februar 2013 zum 6. Mal in Folge an exzellente wissenschaftliche Arbeiten mit hoher Relevanz für die Handelsbranche verliehen. Die Abstracts der eingereichten Arbeiten und Forschungskooperationen der vergangenen Jahre können im Internet eingesehen werden. Hier finden Interessenten auch alle relevanten Kontaktdaten für ihre Fragen und Anregungen zum Thema Wissenschaftspreis.
Weiterführende Informationen: www.wissenschaftspreis.org