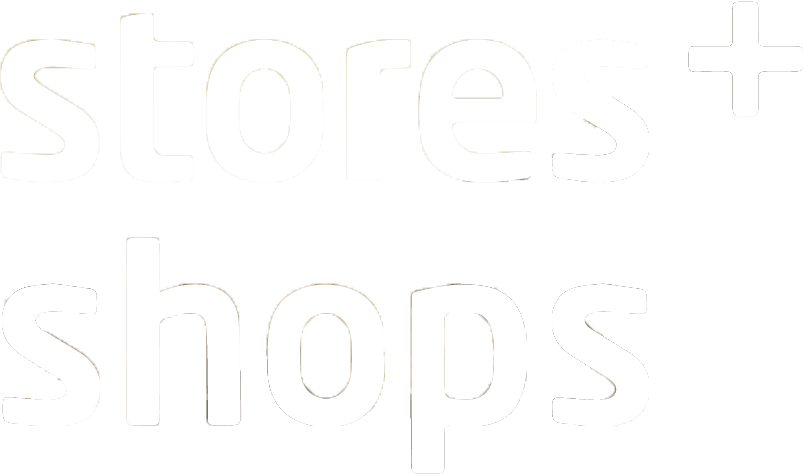1. Zulässigkeit: Die offene Videoüberwachung ist in öffentlich zugänglichen Bereichen und damit auch auf Handelsflächen grundsätzlich zulässig. Sie dient gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, § 6 b Absatz 1) der Wahrnehmung des Hausrechts bzw. der Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke. Händler nehmen durch Videoüberwachung ihr Hausrecht wahr. Die Maßnahme muss erforderlich und verhältnismäßig sein – auch dies ist bei der Videoüberwachung im Handel üblicherweise der Fall.
2. Einschränkungen: Insbesondere sind die verfassungsrechtlich geschützten Persönlichkeitsrechte zu beachten. Hier muss eine Abwägung stattfinden. Die Persönlichkeitsrechte können dann überwiegen, wenn im Raum kommuniziert und sozial interagiert wird – zum Beispiel in Restaurants. Das Arbeitsgericht Hamburg untersagte die Videoüberwachung in einem Coffee-Shop (Beschluss vom 22. 4. 2008). Oder: Im sogenannten Dussmann-Fall wurde dem bekannten Berliner Medienkaufhaus Dussmann auferlegt, seine Kameras im Außenbereich unter den Arkaden nicht auf die dort befindlichen Büchertische zu richten, sondern die Überwachung auf einen Abstand zur Hauswand von einem halben Meter zu begrenzen. Generell tabu ist Videoüberwachung in Sanitär-, Umkleide- und Ruheräumen.
3. Mitbestimmung: Bei der Einrichtung von Videoüberwachungsmaßnahmen ist, falls vorhanden, der Betriebsrat zu beteiligen. Dieser fordert in der Regel den Abschluss einer Betriebsvereinbarung, in der die Zweckbestimmung, die Standorte der Kameras, die Zugriffsberechtigung sowie Speicherung, Auswertung und Nutzung der Daten vereinbart werden. Das Bundesarbeitsgericht hat festgelegt, dass Mitarbeiter durch die Anlagen keinem ständigen Überwachungsdruck und keiner ständigen Leistungs- und Verhaltenskontrolle unterliegen dürfen.
4. Kenntlichmachung: Videoanlagen sind dem Publikum grundsätzlich kenntlich zu machen – zum Beispiel durch Hinweisschilder oder durch das Video-Infozeichen gemäß DIN 33450. Dies gilt auch, wenn nur Kamera-Attrappen eingesetzt werden.
5. Nutzung: Die Verarbeitung und Nutzung von Videosequenzen ist zulässig, wenn sie der Erreichung des verfolgten Zweckes dienen und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schützwürdige Interessen beeinträchtigt werden. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur genutzt werden, soweit dies zur Verfolgung von Straftaten oder zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Das heißt: Videodaten, aber auch Statistiken über die Aufzeichnungen, dürfen zwar an die Polizei, nicht aber an Dritte (z. B. Marktforschung, betriebsfremde Personen) weitergegeben werden.
6. Löschung: Videodaten müssen gelöscht werden, wenn sie zur Erreichung des Zweckes nicht mehr erforderlich sind. Die Gerichte beurteilen hier den Einzelfall: Bei Banken können dies bis zu sechs Wochen sein, im Einzelhandel sind die Lösch-Fristen tendenziell kürzer.
7. Gerichtsverwertbarkeit: Rechtswidrig erlangte Videoaufzeichnungen werden von den Gerichten nicht als Beweismittel anerkannt. Rechtmäßig erlangte Aufzeichnungen müssen qualitativ so beschaffen sein, dass Personen und Vorgänge eindeutig identifizierbar sind. Neben mangelnder technischer Qualität können auch ungünstige Kameraposition oder schlechte Beleuchtungsverhältnisse eine gerichtliche Verwertung unmöglich machen. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Aufzeichnungen nicht zu manipulieren sind bzw. nicht gefälscht werden können.