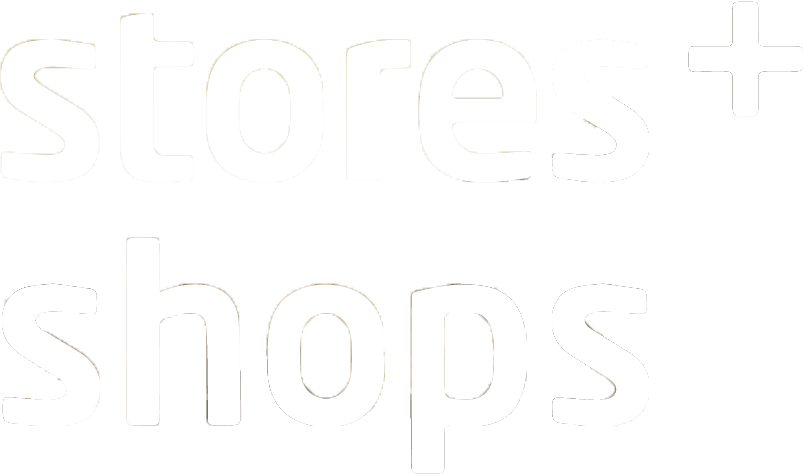Nachdem der bereits 1949 entwickelte Barcode ab 1974 seinen Durchbruch in Konsumgüterindustrie und Einzelhandel erlebte und das Zeitalter der Scannerkassen weltweit einleitete, scheint jetzt bei den Scannern der Zeitpunkt eines Systemwechsels gekommen zu sein. Die rasante Verbreitung von zweidimensionalen Codes macht neue optoelektronische Lesetechniken am POS erforderlich. Zwar sind die Tage der bewährten Barcodes nicht gezählt, wohl aber steht den Laserscannern Konkurrenz durch ebenjene optoelektronischen Scanner, auch Imager genannt, ins Haus. Diese nämlich können neben den neuen mehrdimensionalen Codes auch die bisherigen eindimensionalen Barcodes lesen.
„In zwei Jahren sind Laserscanner in der D-A-CH-Region Vergangenheit“, meint Horst Mollik, Vertriebsmanager Zentraleuropa bei Honeywell. Bereits heute herrsche in zentraleuropäischen Handelsunternehmen die Ansicht, dass bei Neuinvestitionen in Kassenhardware die Komponenten und damit auch die Scanner für die Anforderungen in den nächsten fünf Jahren gerüstet sein müssen.
Mollik steht mit seiner Meinung nicht alleine. „Imager werden Linearscanner auf Dauer komplett ablösen“, sagt Ralf Gerdes, Retail-Produktspezialist bei Toshiba TEC. Begründet wird dies mit neuen Anwendungen und Markterfordernissen, die der Handel nur mit neuer Decodierungstechnologie erfüllen könne. Treibende Kraft bei diesem technologischen Paradigmenwechsel sind die sich rasant entwickelnden Anwendungen auf Basis der zweidimensionalen Codes, allen voran der QR-Code.
Der Vorteil von 2-D-Codes gegenüber den eindimensionalen Strichcodes liegt in ihrer mehrfach höheren Dichte und Menge an Informationen. Die Daten werden nicht nur in einer Richtung (eindimensional) codiert sind, sondern in Form einer Fläche über zwei Dimensionen. 2-D-Codes gibt es in verschiedenen Formaten und Standards vom einfachen, gestapelten Barcode PDF417 (Portable Data File) über Matrixcodes wie den QR-Code (Quick Response Code) bis hin zu noch komplexeren Codes, die weitere „Dimensionen“ verwenden, zum Beispiel Farbcodierungen.
Zum Lesen dieser Codes ist eine spezielle, im Grunde aber einfache Technik nötig. Die Codes werden digital fotografiert und mithilfe einer Software gelesen. Das macht sie im Alltagsgebrauch so universell verwendbar. QR-Codes beispielsweise können mit jedem Foto-Handy genutzt werden, sofern dieses eine kleine spezielle Software besitzt.
Typisches Beispiel aus dem Konsumgüterbereich: Ein Kunde will sich direkt am Regal seines Supermarktes über ein neues Produkt näher informieren. Er fotografiert dafür den auf die Packung aufgedruckten QR-Code mit seinem Handy. Der QR-Code enthält einen verschlüsselten Link zu einer entsprechenden Internetsite, die vom internetfähigen Handy automatisch geöffnet wird.
In ähnlicher Weise gibt es auf Basis von QR-Codes Anwendungen an der Kasse. Das Spektrum reicht von Bonuspunkten und Couponing bis hin zur Aktivierung von Zahlungsfunktionen mit QR-Codes. Um diese Codes von einem Bon, Coupon oder auch vom Handydisplay lesen und im Kassensystem verarbeiten zu können, wird ein 2-D-Imagescanner mit Schnittstelle zur Kassensoftware benötigt.
Imagescanner punkten nach Darstellung der Industrie mit höherer Sicherheit, Genauigkeit und Schnelligkeit. Sicherheit: Verschiedene Obst- und Gemüsesorten können am Checkout mithilfe einer speziellen Bildauswertung identifiziert und preisausgezeichnet werden. Genauigkeit: Imagescanner identifizieren auch beschädigte oder verschmutzte EAN-Codes, bei denen Laserscanner aufgeben müssen. Schnelligkeit: Bereits die aktuellen Imagescanner seien „locker um den Faktor drei“ schneller als Laserscanner, sagt Toshiba-Manager Gerdes. „Sie sind rasend schnell und sehr gut.“ Dabei stecke die Entwicklung der Imager erst in den Kinderschuhen.
„Rasend schnell und gut“
Für den Handel zählen neben der Leistungsfähigkeit noch zwei weitere Aspekte: die Standfestigkeit und der Preis. Zwar sind die Imager im Moment (noch) teurer als die Laserscanner, aber: „Der Preis ist keine Bremse mehr für die Durchsetzung im Handel, denn viele Prozesse sind nur noch per Imagescanner zu bewältigen“, heißt es bei Toshiba TEC. Der Unterschied sei nur noch marginal, und der Markt drücke die Preise weiter nach unten, wie überall in der IT, lautete die Prognose bei Höft & Wessel auf der EuroCIS 2012.
Was die Standfestigkeit betrifft, betonen Hersteller unisono den einfachen und kaum störanfälligen Aufbau der Systeme. Der Imagescanner sei nichts anderes als ein Input-Terminal auf Basis einer Digitalkamera. Im Gegensatz zu Laserscannern mit ihren Drehspiegeln komme keine Mechanik mehr zum Einsatz. Die Software ist ebenfalls wenig komplex und muss im Grunde nichts anderes leisten, als das vom Imager gelieferte Bild zu decodieren und als Ergebnis einen Textstring zur Weiterverarbeitung ins System zu liefern. Der simple Code ist von jedem Softwaresystem als Kommandozeile nutzbar.
Im Gegensatz zum Handy haben professionelle Imager, wie sie am POS zum Einsatz kommen, diese Software als Firmware integriert, was für hohe Geschwindigkeit sorgt. Auch die Tiefenschärfe der optischen Systeme ist so groß, dass die Codes in einem relativ beliebigen Abstand zum Objektiv sauber gelesen werden, was für flüssige Scanvorgänge sorgt. Für seinen Handscanner „EL57“ nennt Wincor Nixdorf beispielsweise eine Distanz von 2-25 cm.
Der Handel hat bei der Hardwarekonfiguration die Wahl zwischen unterschiedlichen Varianten. Auf Dauer geht die Entwicklung nach Ansicht der Industrie zu festinstallierten Imagern, die die bisherigen Laserscanner im Kassentisch ersetzen. Verfügbar sind solche stationären Imager sowohl für den vertikalen als auch horizontalen Einbau. Die Systeme „EL60“ (horizontaler Einbau) und „61“ (vertikal) von Wincor-Nixdorf beispielsweise erkennen lineare 1-D-, 2-D- und GS1-DataBar-Barcodes und sind auf hohe Warendurchsätze an der Kasse ausgelegt. Sie eignen sich auch für das Auslesen von QR- und Barcodes von Mobiltelefonen und PDAs.
Den ersten Hybridscanner mit Laserscanner und Imager hat NCR Anfang 2011 vorgestellt. Das System ist nach Herstellerangaben kompatibel mit Kassensystemen anderer Anbieter. Von NCR gibt es inzwischen auch ein Kassenterminal mit einem integrierten bi-optionalen Laserscanner und zusätzlich zwei Imagescannern: einen auf Seite der Kassiererin, einen auf Kundenseite. Mit dem kundenseitigen Imager kann der Kunde Bonuskarten-Buchungen oder Zahlungen vornehmen, ohne sein Handy oder seine Kundenkarte der Kassiererin noch aushändigen zu müssen. Auch Honeywell hat auf der EuroCIS seine neueste Generation der bi-optischen Systeme mit stationärem Laserscanner und Imager in einem Gerät demonstriert. Standard ist hier der Imager auf Seite der Kassiererin, optional kann ein zweiter auf Kundenseite installiert werden.
Übergangsweise wird eine Nachrüstung der bisherigen Kassenplätze mit zusätzlichen fest installierten oder mobilen Imagern das Bild im Handel bestimmen. Diese stehen ebenfalls in reicher Auswahl zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Handscanner „4600r“ von Honeywell, der das schnelle Scannen von linearen Barcodes bietet und außerdem alle 2-D-Barcodes lesen kann. Die integrierten Anschlussfunktionen unterstützen laut Honeywell die Bandbreite an Einzelhandels-Systemschnittstellen und ermöglichen so eine einfache Anbindung und einen flexiblen Einsatz.
Ganz indes werden sich die bisherigen Linearscanner nicht aus dem Handel verabschieden. Für bestimmte Zwecke, etwa zum Erfassen der engen Codezeilen in Orderlisten, werden Lesestifte das Mittel der Wahl bleiben. Für solche Zwecke sind 2-D-Scanner nicht geeignet, weil sie immer mehrere Zeilen erfassen. Höft & Wessel verkauft im Einzelhandel noch zahlreich laserbasierte Geräte – und erklärt das auch mit der „Macht der Gewohnheit“. Bei einigen anderen mobilen Anwendungen im Handel beobachtet Höft & Wessel jedoch den zunehmenden Einsatz von Handhelds mit Imagern. In der Transportlogistik seien Imager ohnehin längst unabdingbar, weil die 2-D-Logistikcodes hochkomplexe Informationen enthalten, die in 1-D nicht darstellbar sind.
Fotos: Honeywell (2), NCR (1), Höft & Wessel (1)
Die Software
Ralf Gerdes von Toshiba TEC betont, dass der Handel sein Augenmerk nicht nur auf die Hardware richten müsse, sondern auch auf entsprechende Software, die die Nutzung neuer Anwendungen auf Basis der 2-D-Codes ermöglicht. Sein Unternehmen entwickelt unter anderem Softwarelösungen zur Anbindung von mobilem Couponing und anderen Formen der Kundenbindung, die den Betrieb auf beliebigen Kassensystemen ermöglichen und die für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet sind. „Es gibt in Europa bereits ganz andere Formen individueller, personenbezogener Werbung, als wir sie hier in Deutschland verwenden,“ sagt Gerdes. Voraussetzung hierfür ist, dass die Software auch den Kunden erkennen könne. Bei der Nutzung der neuen Möglichkeiten, die 2-D-Codes bieten, komme es darauf an, dass die Software dem Händler individuelle Möglichkeiten im Rahmen einer Standardlösung bietet.
Noch größere Distanzen
Neben dem Erkennen von Barcodes aller Art spielt im Handel die RFID-Technologie als weiteres System der Warenidentifizierung eine Rolle. Der RFID-Spezialist Nordic ID hat auf der EuroCIS als Messeneuheit das RFID-Modul „NUR“ vorgestellt, das Reichweiten von bis zu
10 m ermöglicht. Ab sofort werden alle Geräte mit diesem Modul ausgerüstet. Bereits das kleinste Handheld schafft damit eine Reichweite von 2,50 m. Hohe Reichweiten sind auch bei Kompaktgeräten gefragt, etwa wenn auf den Flächen Inventuren erledigt werden. Bei den RFID-Lesegeräten kommen ebenfalls zunehmend Hybridlösungen auf den Markt. Von Nordic ID gibt es Handhelds mit RFID-Modul und einem Laserscanner oder Imager. Ganz also wird die Linse den Laser vorerst nicht ablösen.