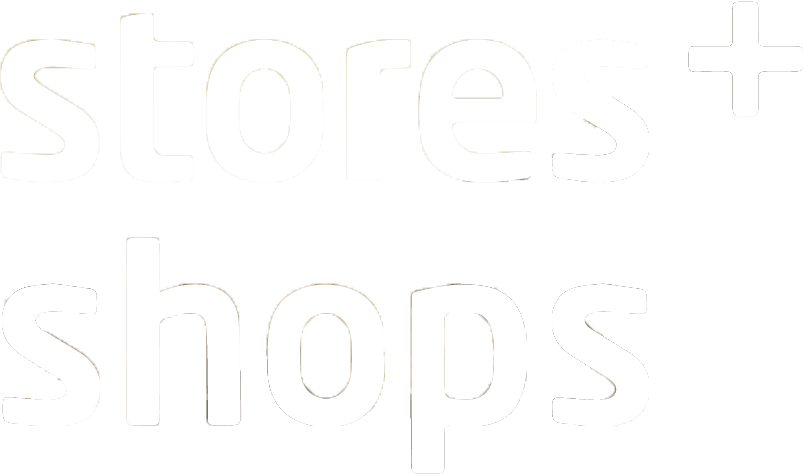Dass bei dem jungen Architekturstudenten Jochen Messerschmid das Bewusstsein für die Bedeutung der Decke schon früh geweckt wurde, hängt mit seinem Lieblingsprofessor zusammen. Der heute in Wien lebende Architekt Boris Podrecca, der seinerzeit die Leitung des Instituts für Raumgestaltung und Entwerfen an der Stuttgarter Universität innehatte, hat seinen Studenten immer wieder bewusst gemacht, dass „die Raumwahrnehmung nicht nur über den Boden und die Wände erfolgt“, wie Messerschmid sich erinnert, „sondern über die Trilogie Boden-Wand-Decke“.
Bis heute steht daher die Auseinandersetzung mit der Decke für den Stuttgarter Architekten am Anfang des gestalterischen Prozesses. „Ich beginne immer auch damit, dass ich mir die Decke in Verbindung mit den Raumstrukturen anschaue“, so Jochen Messerschmid, „das kann man gar nicht auseinanderdividieren, denn es geht immer um den Gesamteindruck.“
Intensive Gedanken
Ist das Bewusstsein für die Bedeutung der Deckengestaltung und damit die Bereitschaft, in diese zu investieren, bei den Bauherren aus dem Einzelhandel ebenso ausgeprägt? Zumindest wird die Decke mittlerweile als wesentlicher Bestandteil des Raumes identifiziert, ihre Wirkung und Bedeutung zunehmend erkannt, was beispielsweise in der Lebensmittelbranche derzeit zu beobachten ist. Doch egal in welcher Branche, ob Multilabel-Platzhirsch, Spezialist in Stadtteillage oder Monomarken-Konzept – jedem stationären Händler ist inzwischen klar: Ein Store, der zukunftsfähig sein will, muss rundum überzeugen.
„Man muss einen Laden heute 360 Grad denken“, sagt Ansgar Schmidt von S1 Architektur, Berlin, „und dazu gehört, sich auch über die Decke intensive Gedanken zu machen.“ Denn auch bei der Decke geht es letztendlich darum, für seine Handelsmarke einen differenzierten Look im Verkaufsraum und damit eine eigene Identität zu schaffen.
Vor jedem Nachdenken über den gestalterischen Weg, den man gehen will, steht die Betrachtung der Immobilie, die oft eine bestimmte Deckengestaltung nahelegt. „Einem alten Gebäude muss ich Respekt zollen“, sagt Ansgar Schmidt von S1 Architektur, „und wenn ich eine tolle alte Decke habe, ist es schön, die zu zeigen, weil ich damit auch die Geschichte des Gebäudes zeige.“ Judith Haase von Gonzalez Haase Architektur, Berlin, geht noch weiter: „Im Grunde gestalten wir Decken nicht“, sagt sie, „wir zeigen die Substanz eines Gebäudes und verdecken nichts.“
Authentizität
Die Substanz eines Gebäudes zeigen – hier geht es um Authentizität. Die in den letzten Jahren so beliebte offene Industriedecke macht demnach nur Sinn, wenn sie dem Charakter des Gebäudes entspricht. „Die offene Industriedecke ist ein Gestaltungselement, das aus einer bestimmten Stilrichtung entstanden ist und nach wie vor seine Berechtigung hat“, sagt Heiner Huber von mhp Architekten, München, „ob es aber sinnvoll ist, einen loftartigen Charakter zu kreieren, hängt vom Projekt und dem Planungsziel ab und von den Möglichkeiten, die das Bestandsgebäude bietet.“
Auch Jutta Blocher von Blocher Blocher Partners in Stuttgart macht ein Deckendesign im Industriecharakter davon abhängig, ob es in dem jeweiligen Gebäude authentisch ist. Ohnehin glaubt sie, dass der Höhepunkt des Industrie-Looks überschritten ist und „der Trend wieder mehr zu einer aufgeräumten Situation geht“. Auch Ansgar Schmidt sieht das so: „Man muss nicht alles roh lassen, es geht auch wieder mehr hin zur Gestaltung.“ Natürlich hat hier auch die jeweilige Branche und das Produkt ein Votum. Was für den Jeansladen Top ist, kann für hochwertige Damenmode klassischer Stilrichtung Flop sein. Die perfekte Lösung muss nicht in einem strikten Entweder-oder liegen, sondern vielleicht in einem kreativen Sowohl-als-auch. So kann man eine Decke roh belassen und nur Teilsegmente abhängen. „Wir arbeiten teilweise mit abgehängten Decken mit unterschiedlichen Öffnungen, spielen quasi durch offene und geschlossene Decken mit wechselnden Raumhöhen“, sagt Heiner Huber von mhp Architekten, „Aufgabenstellung und Entwurfsziel sind dabei aber immer die entscheidenden Kriterien.“
Teil-Abhängungen
Durch Teil-Abhängungen erzeugte unterschiedliche Höhen oder Ebenen können auch sinnvoll sein, in über Jahre gewachsenen An- und Umbauten einzelne Bereich klar zu definieren. Grundsätzlich sorgen Teil-Abhängungen für dramaturgische Höhepunkte im Raum. „Hohe und niedrige Raumbereich in einer Einheit, das kann sehr spannend sein“, meint Heiner Huber. Einer glatten Decke kann man mithilfe unterschiedlicher Materialien wie beispielsweise Holzlamellen oder Metallelementen Spannung, Struktur und Volumen geben – und nebenher positiv auf die Akustik einwirken.
Kosten
Und die Kosten? Mit 50-100 Euro pro Quadratmeter, im Schwerpunkt 70-80 Euro pro Quadratmeter muss man für eine gestaltete Decke rechnen, es gibt auch Low-Budget-Lösungen, beispielsweise durch den Einsatz von Farbe oder Folien. Wofür man sich entscheidet, in jedem Fall „kann ich mit der Decke wunderbar Akzente setzen“, meint Jutta Blocher.
Eine besonders spannende Möglichkeit hierfür sieht Klaus Schwitzke von Schwitzke, Düsseldorf, im Zusammenspiel mit Licht. Dabei geht es nicht nur darum, den Raum und die Ware gut auszuleuchten, sondern, so Schwitzke: „auch eine eigene Formensprache des Lichts für die Marke oder das Handelskonzept zu finden“. Das bedeutet eine so spezifische Art des Umgangs mit Licht, dass sich die Atmosphäre im Raum von der Stimmung in anderen Handelskonzepten deutlich abhebt. Das Lichtkonzept wird so in Verbindung mit der Decke Teil der Markensprache und ein Mittel zur Differenzierung.
Generell geht man, so Schwitzke, dazu über, Licht „unsichtbar zu machen“, speziell in trendigen Konzepten setzt man das Licht meist auf eine reduzierte, minimalistische Art ein. Schwitzke: „Es geht eher um die Wirkung des Lichts als um die Leuchte selbst als Gestaltungsmittel.“ Auch Judith Haase integriert das Licht „auf eine Weise, dass es nicht als Licht wahrnehmbar ist“. Das heißt in der Praxis: Das Licht wird „versteckt“, in der Kontur von Deckenabsätzen, in Lichtschlitzen oder -schächten. Um die Lichttechnik, die Haustechnik und die Brandschutzinstallationen unter abgehängten Decken verstecken zu können, braucht man mindestens 50, besser aber 70 cm Spiel. Eine Deckengestaltung gilt als gelungen, wenn sie ein Differenzierungsmerkmal für die jeweilige Marke darstellt und im Zusammenspiel mit Licht die Warenpräsentation optimal unterstützt. Und dann, so Klaus Schwitzke: „Wenn alle, Kunden und selbstverständlich auch die Mitarbeiter, sich wohl fühlen im Verkaufsraum.“
Fotos (4): Blocher (1), Ganter Interior (1), Gonzalez Haase (1), Schwitzke (1)
![]() Spiel mit den architektonischen Mitteln
Spiel mit den architektonischen Mitteln
Bernd Kast, Leiter der Planung/Head of Design bei Wanzl Ladenbau, über den gestalterischen Aufbruch der Lebensmittelbranche in Sachen Decke.
Welchen Stellenwert hat die Deckengestaltung im Lebensmittel-Bereich?
Früher hat man sich auf Boden und Wand konzentriert. Doch auf dem Boden stehen die Regale, und auch die Wände sind größtenteils von den Regalen bedeckt – da bleibt die Decke als größte zu bespielende Fläche, über die oft gar nicht nachgedacht wurde. Dabei bietet die Decke einen sehr großen gestalterischen Spielraum und damit die Möglichkeit, einen Verkaufsraum ganzheitlich zu inszenieren, seine Identität herauszuarbeiten und damit sich abzuheben. Wir haben seit circa zwei Jahren enorm viele Kunden, die genau das möchten. Tatsächlich entdeckt der Lebensmittelhandel gerade die Bedeutung des architektonischen Gesamtwerks für sich.
Woher kommt dieser Bewusstseinswandel?
Zunächst mal spielt man mit einer gelungenen ganzheitlichen Gestaltung seinen Vorteil gegenüber dem Onlinehandel aus. Hinzu kommt: Auf der ganzen Welt schaut vieles gleich aus. Viele Lebensmitteleinzelhändler möchten aber nicht, dass beispielsweise ihr Markt am Bodensee genauso aussieht wie ein Markt in Hamburg. Daher erleben wir gerade eine Art Unikatsentwicklung: Jeder, der es finanzieren kann, möchte, dass sein Markt lokaltypisch geprägt ist.
Was ist speziell im Food-Bereich hinsichtlich der Deckengestaltung wichtig?
Das Entscheidende ist das Spiel mit den architektonischen Mitteln. Es gilt, den Raum zu ordnen, zu erschließen. Zu diesem Zweck kann man beispielsweise Deckenelemente in geometrischen Formen und in geeigneten Materialien wie Holz, Acryl, Stoff, Blech oder Trockenbauelemente nehmen und mit ihnen spielen. Man hängt sie nicht unbedingt waagerecht von der Decke ab, sondern vielleicht schief oder in verschiedenen Höhen. Man kann auch transparente Flächen mit Deckensegeln kombinieren. Durch Deckenelemente aus Holz kann man zum Beispiel in der Weinabteilung eine gemütliche Atmosphäre erzeugen. In einem Markt haben wir 300 Laub-Blätter aus Acryl von der Decke abgehängt.