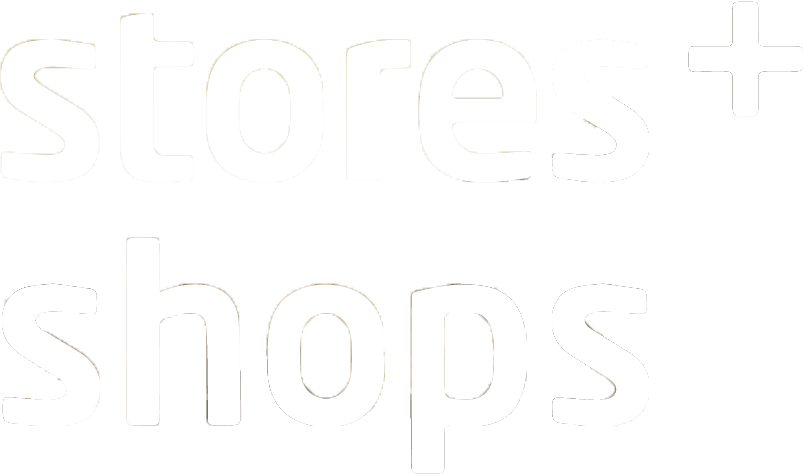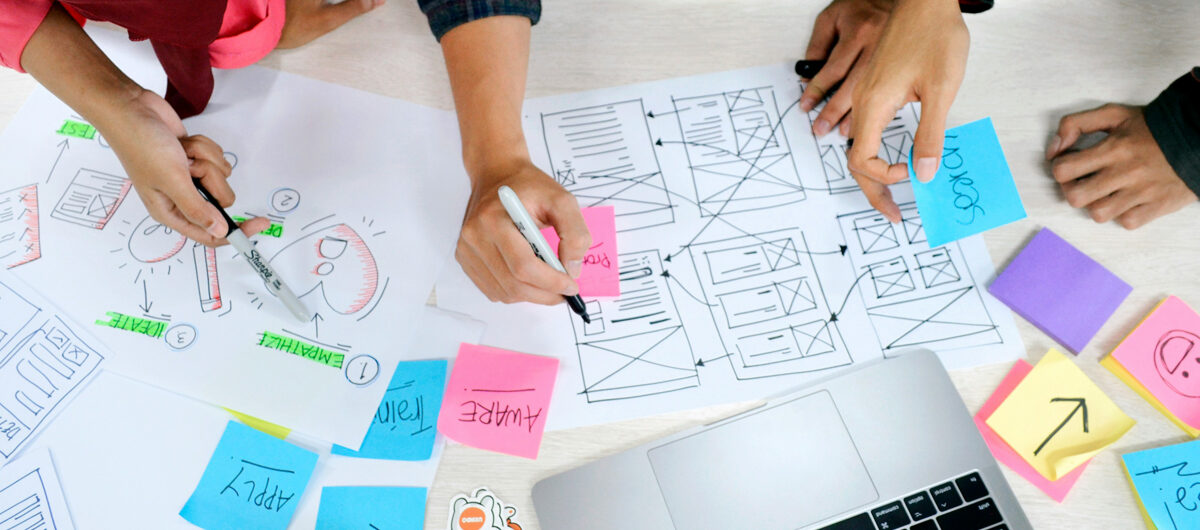Für Handelsunternehmen sind mittlerweile viele technologische Neuerungen möglich – auch ohne tiefgreifende IT-Kenntnisse. No-Code-Lösungen und sogenanntes „vibe coding“ versprechen schnelle Anwendung und einfache Integration in bestehende Prozesse. Viele Dienstleister versprechen Automatisierungen in wenigen Klicks. Die Erwartungshaltung bei Unternehmen sind dementsprechend groß. Sie erhoffen sich schnelle Effizienzgewinne und skalierbare Prozesse.
Komplexe Abläufe erfassen
Die Realität sieht oft anders aus. Wird vorschnell mit der Automatisierung begonnen, fehlen oft klare Strukturen, Zieldefinition oder Verantwortlichkeiten. Prozesse werden nur teilweise automatisiert oder sind am Ende aufwendiger als zuvor. Die Folge: Frustration und das schnelle Ende des Projekts. Bevor Prozesse automatisiert werden, sollten Händler die Komplexität der Abläufe erfassen und identifizieren, ob überhaupt eine Automatisierung nötig ist. Auch No-Code-Tools folgen eigenen Logiken. Wer sie ignoriert, läuft Gefahr, ineffiziente oder fehlerhafte Abläufe zu etablieren. Vor der technischen Umsetzung sollten daher strategische Fragen beantwortet werden: Welche Prozesse bieten Potenzial? Wer trägt Verantwortung? Wo beginnt man sinnvollerweise?
Strategisch handeln
Automatisierung ist eine strategische Aufgabe. Es braucht Verantwortliche mit fundiertem Prozessverständnis. Nur sie können geeignete Abläufe identifizieren, kennen die einzelnen Schritte und sind in der Lage, Automatisierungen logisch abzubilden. Die Analyse der bestehenden Prozesse ist die Basis jeder erfolgreichen Automatisierung. Bei der Identifikation geeigneter Prozesse helfen einige Kriterien: Automatisiert werden können Aufgaben, die regelmäßig, standardisiert und regelbasiert ablaufen.
Prozesse mit hohem manuellem Aufwand oder Fehleranfälligkeit sind besonders geeignet – vorausgesetzt, sie basieren auf strukturierten, digitalen Informationen, auf die Tools zugreifen können. Dementsprechend eignen sich kreative, menschliche Entscheidungen weniger zur Automatisierung. Technische Anforderungen und Systemkompatibilität Neben der Prozessauswahl ist die technische Infrastruktur entscheidend. ERP-, PIM- oder CRM-Systeme müssen mit den eingesetzten Automatisierungstools kompatibel sein. Plattformen wie Zapier, Make oder N8n benötigen entsprechende Schnittstellen. Je nach Systemarchitektur kann auch eine individuelle Lösung notwendig sein.
Visualisierung
Sobald Prozesse und Tools definiert sind, sollte die Umsetzung möglichst kleinteilig erfolgen. Kleine Automatisierungsschritte lassen sich einfacher testen, anpassen und erweitern. So muss bei Änderungen nicht der gesamte Ablauf verworfen werden. Trotz No-Code-Versprechen gilt: Nicht jede Automatisierung ist ohne technisches Know-how möglich. Für komplexere Anforderungen lohnt es sich, externe Expertise hinzuzuziehen. Jeder Automatisierungsprozess beginnt mit der Definition. Ein Beispiel ist der Retourenerfassungsprozess. Zentrale Fragen sind hier: Wer trägt die Verantwortung? (z. B. Retourenmanager) Was ist das auslösende Ereignis? (z. B. Eingang der Retoure) Welche Entscheidungen werden getroffen? (z. B. Zustand, Folgeschritte) Welche Prozessschritte folgen? (z. B. Erfassung und Meldung) Wann ist der Prozess abgeschlossen? (z. B. Rückerstattung an Kunden).
Helfen kann es, Prozesse visuell zu dokumentieren, z. B. mit einem Mermaid-Diagramm. Das schafft Klarheit und ermöglicht laufende Anpassungen. Aus diesem Plan können einzelne Schritte herausgelöst und nach und nach in eine Automatisierungsplattform übertragen werden. Anfangs erscheinen die Erfolge oft unspektakulär. Doch durch jeden Schritt wächst sowohl der Automatisierungsgrad als auch das Verständnis für Prozessgestaltung. Wer dranbleibt, entwickelt langfristig ein System, das sich flexibel weiterentwickeln lässt.
Gastautor Robert Wall ist Geschäftsführer von T4DT.