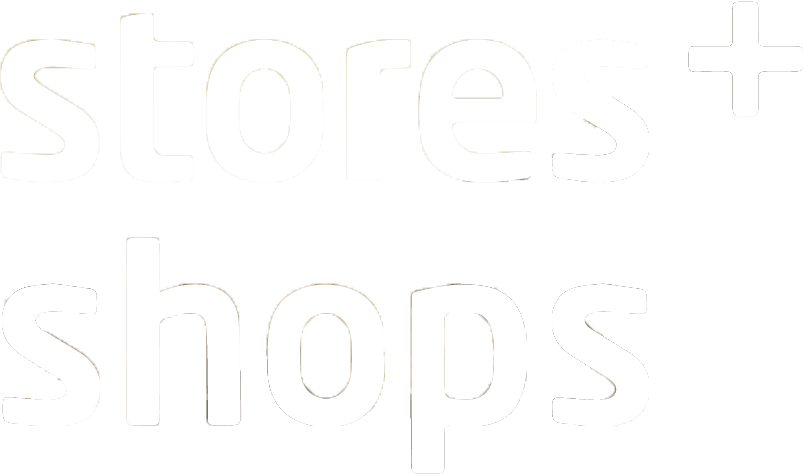Die Meinungen gehen weit auseinander. Auf der einen Seite fordern Politik und Wirtschaft eine Vereinfachung, Verwässerung oder gar Abschaffung der Gesetze. Auf der anderen Seite „verteidigen“ bekannte Persönlichkeiten wie Michael Otto, der frühere Chef des Versandhändlers Otto, oder die deutsche Unternehmerin Antje von Dewitz die Gesetze.
Im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist klar formuliert: Das LkSG soll abgeschafft und ersetzt werden „durch ein Gesetz über die internationale Unternehmensverantwortung, das die Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) bürokratiearm und vollzugsfreundlich umsetzt.“ Die Berichtspflicht nach dem LkSG soll komplett entfallen. Die LkSG-Sorgfaltspflichten sollen weiterhin gelten, aber nicht sanktioniert werden. Unterstützt wird seitens der Koalition das sog. Omnibus-Verfahren der EU. Diese Initiative zielt auf eine Vereinfachung und Reduzierung des bürokratischen Aufwands für Unternehmen im Zusammenhang mit nachhaltigkeitsbezogenen EU-Regulierungen ab und beinhaltet eine vorübergehende Aussetzung des CSRD-Umsetzungsplans.
Wenn man den Koalitionsvertrag als gesetzt betrachtet, werden CS3D und CSRD – mit entsprechenden bürokratischen Vereinfachungen im Rahmen von „Omnibus“ – in den kommenden Jahren geltendes Recht werden. In der neuen Großen Koalition herrscht allerdings keine Einigkeit darüber, wie es genau weitergehen soll. Nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz gefordert hat, das CS3D komplett abzuschaffen, haben Vizekanzler Lars Klingbeil und die EU-Kommission hier klar Position für CS3D bezogen (Quelle: Handelsblatt, 12.05.25). Am 19.05.25 haben sich 90 führende europäische Ökonominnen und Ökonomen für das europäische Lieferkettengesetz ausgesprochen (Quelle: Wirtschaftsmagazin Surplus oder Frankfurter Rundschau, 19.05.25).
Der aktuelle „Omnibus“-Entwurf sieht nun u. a. eine Reduktion des Berichtsumfangs hinsichtlich CS3D und CSRD vor. Wichtig in diesem Zusammenhang: CS3D und CSRD haben nicht nur eine Wirkung auf verpflichtete Unternehmen, sondern auch auf deren Lieferanten. Diese sind generell aufgefordert, ihre verpflichteten Kunden bei der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen angemessen zu unterstützen. Diese Forderung betrifft nicht nur die unmittelbaren Lieferanten, die in einem direkten Vertragsverhältnis mit den verpflichteten Kunden stehen, sondern auch die gesamte nachgelagerte Wertschöpfungskette im In- und Ausland (mittelbare Lieferanten). Kurz: Die Verantwortung eines verpflichteten Unternehmens endet nicht länger am „eigenen Werkstor“.
Unabhängig von den konkreten gesetzlichen Regelungen des Lieferkettengesetzes („Hard law“) verlangen Kunden und Nichtregierungsorganisationen (NGO) von Unternehmen immer öfter, dass deren Lieferketten belastbare Menschenrechts- und Umweltstandards erfüllen („Soft Law“). Aufgedeckte Verstöße können zu irreparablen Reputationsschäden führen.
CS3D und CSRD bieten Ladenbauunternehmen die Möglichkeit für einen temporären, nur schwer imitierbaren Wettbewerbsvorteil.
Dr. Christian Hilz
Konträre Handlungsoptionen
Zu den nicht-verpflichteten Unternehmen dürften aktuell die meisten Einzelhändler und Ladenbauer zählen. Angesichts dieser noch ungeklärten Position stehen diese vor der grundlegenden Frage, wie sie sich als „nicht-verpflichtetes“ Unternehmen positionieren sollen. Im Grunde gibt es zwei konträre Handlungsoptionen:
Erstens könnte man eine abwartende Strategie („Vogel-Strauß-Strategie“) wählen. Als Unternehmen würde man die Dinge auf sich zukommen lassen und erst dann aktiv werden, wenn konkrete Aufforderungen zum Handeln an das jeweilige Unternehmen herangetragen werden. Kurzfristig würde das Unternehmen Zeit, Kosten und nicht zuletzt Nerven sparen. Denn im durchaus denkbaren Fall werden die europäischen Gesetze gar nicht erst in nationales Recht transferiert.
Ein ernstzunehmendes Risiko kann entstehen, wenn der Ladenbauer bereits heute für ein verpflichtetes Unternehmen tätig ist und/oder kurzfristige Ad-hoc-Prüfungen durchgeführt werden. In diesem Fall muss das Ladenbauunternehmen seine eigene Lieferkette transparent hinsichtlich der gesetzlichen Sorgfaltspflichten abbilden und darüber seinem verpflichteten Kunden berichten. Da die generischen Prozesse im Ladenbau zu einem hohen Prozentsatz kundenunabhängig sind, reicht es, wenn nur ein verpflichtetes Unternehmen auf das Ladenbauunternehmen zukommt. In diesem Zusammenhang spricht man von einem „Musketierrisiko“ („einer für alle“), da ein Großteil des Aufwands zur Erfüllung der LkSG-Anforderungen nur beim ersten Mal anfällt.
Zweitens könnte man eine proaktive Strategie wählen und das LkSG als Quelle für einen temporären Wettbewerbsvorteil sehen („antifragile Strategie“). Wenn man als nicht-verpflichtetes Unternehmen zumindest die wesentlichen Grundzüge des LkSG umsetzt, ergeben sich erstens gewisse Gestaltungsmöglichkeiten in der Umsetzung, zweitens bietet das LkSG die Chance, die eigene Wertschöpfungskette im Ladenbau transparenter und resilienter zu gestalten. Zum dritten könnte die proaktive Erfüllung des LkSG dem Ladenbauunternehmen aus dem Blickwinkel der verpflichteten Kunden spürbare Mehrwerte bringen. Eine Zusammenarbeit könnte aus dem Blickwinkel des verpflichteten Unternehmens dessen LkSG-Risiko deutlich reduzieren. Zudem verringert sich das projektspezifische Umsetzungsrisiko für verpflichtete Einzelhändler, da das Ladenbauunternehmen seine Lieferkette transparenter und resilienter ausgestaltet hat.
Die proaktive Strategie hat den Nachteil, dass sie bereits jetzt Ressourcen bindet und Geld kostet. Sie zwingt dazu, bewusst neue Wege zu gehen, neue Partner bzw. Netzwerke zu finden und mögliche Frustrationen zu tolerieren. Für die proaktive Strategie spricht ein gewichtiges Argument: Im CS3D ist vorgesehen, dass verpflichtete Unternehmen einen Klimaschutzplan verabschieden und umsetzen müssen, um bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu wirtschaften. Der Einzelhandel muss hier zwingend mit seinen Lieferanten enger verzahnt zusammenarbeiten, da nur zwei Prozent der CO2-Emissionen im Handel der direkten Kontrolle der Branche unterliegen. 98 Prozent entfallen auf Scope 3 und liegen damit in der Wertschöpfungskette (Quelle: Studie Oliver Wyman, Juni 2024). Ladenbauunternehmen, welche sich für die proaktive Strategie entscheiden, können ihren Kunden im Einzelhandel wertvolle Beiträge zur Erreichung deren Klimaschutzpläne leisten.
Antifragiler Wettbewerbsfaktor
Ob CS3D und CSRD als Chance oder Risiko begriffen wird, muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Grundsätzlich bieten beide Gesetzesinitiativen Potenzial. Durch die aktuell anstehenden Omnibus-Beschlüsse kündigt sich zeitnah die „scharfe“ Umsetzung an. Die Zeit bis dahin sollte mit der Etablierung von stabilen CS3D/CSRD-Prozessen genutzt werden, auch deswegen, um zukünftige Projekterfolge aufgrund von möglichen Verstößen gegen CS3D/CSRD nicht zu gefährden. Das „Damoklesschwert“ CS3D/CSRD könnte für Ladenbauer die Quelle für einen antifragilen Wettbewerbsfaktor in der Zukunft sein.