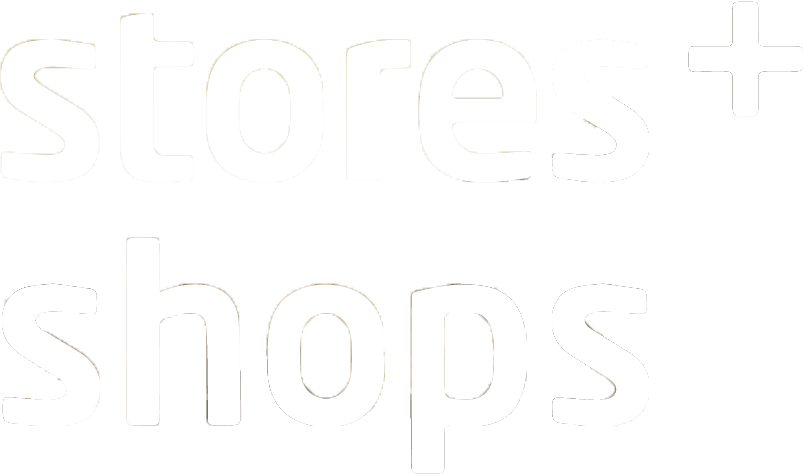Findet der Kunde nicht die gesuchte Ware im Regal, dann ist das oft mit negativen Konsequenzen für den Einzelhändler verbunden. Um diese zu vermeiden, kann dem Fehlen von Produkten durch verschiedene Maßnahmen entgegengewirkt werden, zum Beispiel durch die Erhöhung der Lagerbestände. Doch nach Ansicht des Sicherheitsexperten Dr. Ulrich Franke, Leiter des Instituts für Supply Chain Security gibt es noch eine andere Handlungsoption, um Fehlbestände in den Griff zu bekommen: die Analyse aller Prozesse innerhalb der gesamten Lieferkette vom Distributionslager des Herstellers bis hin zum POS.
Um die Ursache von Fehlbeständen im Regal zu ermitteln, reicht es nicht, die Inventurdifferenzen einmal im Jahr zu ermitteln, damit ist keine valide Analyse möglich. Nur mit einer kontinuierlichen Wareneingangskontrolle ist es möglich, die Gründe zu einem späteren Zeitpunkt zu rekonstruieren. Verluste werden oft pauschal internem bzw. externem Diebstahl zugeschrieben, es kann aber sein, dass die Ursache entlang der Lieferkette entstanden ist. Dr. Ulrich Franke sagt: „Warenschwund kann seinen Ursprung bereits im Filiallager, bei der Kommissionierung der Ware im Distributionslager oder beim Transport haben.“
Systematische Methodik statt krisenbasierter Schnellschuss.
Dr. Ulrich Franke
Zwar belegen Studien, dass sowohl die „externen“ Ladendiebstähle im großen Stil durch organisierte kriminellen Banden aus Osteuropa als auch die „internen“ Diebstähle in den letzten Jahren zugenommen haben; allein die Zahl der schweren Vorfälle ist im Vergleich zum letzten Jahr um 9,5 Prozent gestiegen. Doch ist dies nur die eine Seite. Auch die Vorkommnisse entlang der gesamten Prozesskette stiegen an. So zeigen Zahlen aus 2013 (Quelle: Freightweight/TAPA) für den Bereich EMEA, dass sich die Zahl der Diebstähle aus Produktions- und Lagerhallen mehr als verdreifacht hat.
Die Einzelhandelsunternehmen setzen für die Prävention in erster Linie auf technische Lösungen wie die offene Kameraüberwachung. Doch dadurch allein lässt sich der Warenschwund nicht eindämmen.
Technische Maßnahmen
Um dem Schwund effizient entgegenzuwirken, bedarf es nach Ansicht von Dr. Ulrich Franke auch einer systematischen Methodik im Gegensatz zu einem „krisenbasierten Schnellschuss nach einem gravierenden Vorfall“. Wichtig sei in diesem Zusammenhang der Aufbau entsprechender organisatorischer Strukturen. Ein Modell für eine optimierte Umsetzung von Prävention wurde mit der ECR-Shrinkage-Roadmap entwickelt. Die ECR (Efficient Consumer Response) ist eine Initiative zur Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Händlern, die auf Kostenreduktion und die bessere Erfüllung der Konsumentenbedürfnisse zielt.
Bei diesem Ansatz werden im ersten Schritt alle Prozesse, die im Rahmen der Lieferkette stattfinden, dokumentiert und dann auf ihr Risikopotenzial für die Entstehung von Inventurdifferenzen hin analysiert. Im Rahmen der Untersuchung werden alle Prozesse der Lieferkette dahingehend überprüft, welche Folgen ein Fehler hervorrufen könnte, wie wahrscheinlich bzw. häufig dieser auftreten kann und mit welcher Wahrscheinlichkeit dieser Fehler ermittelt wird. Auf dieser Basis können dann die Bewertung der Fehlerquellen gemäß ihrem Risiko vorgenommen und entsprechende Verbesserungs- bzw. Präventionsmaßnahmen entwickelt werden. Insgesamt definiert die Roadmap alle notwendigen Prozessschritte, die dann im Weiteren sequenziell logisch abzuarbeiten sind.
Eine der Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung der Roadmap ist, dass „das Management zur Minimierung von Warenverlusten Teil des ‚Retail Lean Management’ wird und dieselbe Wichtigkeit und Gewichtung wie andere Unternehmensfunktionen erhalten muss“. Hierzu gehört beispielsweise die Formulierung einer Unternehmensleitlinie zur Reduzierung von Warenverlusten, in der unter anderem stehen sollte „welche Regeln der Kooperation mit Supply-Chain-Partnern eingefordert, vereinbart und gepflegt werden bzw. werden sollen.“
Unternehmensleitlinie
Die ECR-Shrinkage-Roadmap bietet keinen vorkonfektionierten Katalog mit Empfehlungen für die Implementierung fertiger technischer Lösungen und organisatorischer Maßnahmen. Für die Umsetzung ist erforderlich, so Franke, dass „die Verantwortlichen sich mit den Prozessen beschäftigen“. Denn eine Grundlage für die Bewertung ist die detaillierte und individuelle Analyse der gesamten Lieferkette und, darauf basierend, die Quantifizierung der Ursachen. Erst nach Auswertung aller Fakten wird es dann möglich, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die unter dem Kosten-Nutzenaspekt dazu geeignet sind, die bestehende Situation zu verbessern.
Essenziell ist, so Dr. Franke, der „gut abgestimmte Mix zwischen technischen und organisatorischen Maßnahmen“. Das Potenzial, um robuste Prozesse entlang von Lieferketten zu schaffen, ergibt sich nach Aussage des Sicherheitsexperten „hauptsächlich in den Logistik- und Filialprozessen sowie der Personalauswahl und -führung“. Ein wichtiger Punkt sei hierbei – neben der allgemeinen Mitarbeiterschulung –, Mitarbeiter zu bestimmen, die für die Überwachung und Einhaltung der definierten Prozesse verantwortlich sind. Denn auch wenn per Vorschrift die Tür zum Warenlager immer abgeschlossen sein muss, kann es doch passieren, dass dies in der Praxis aus Bequemlichkeit nicht umgesetzt wird.
Foto: Fotolia / industrieblick
Weitere Informationen: www.supply-chain-security.org